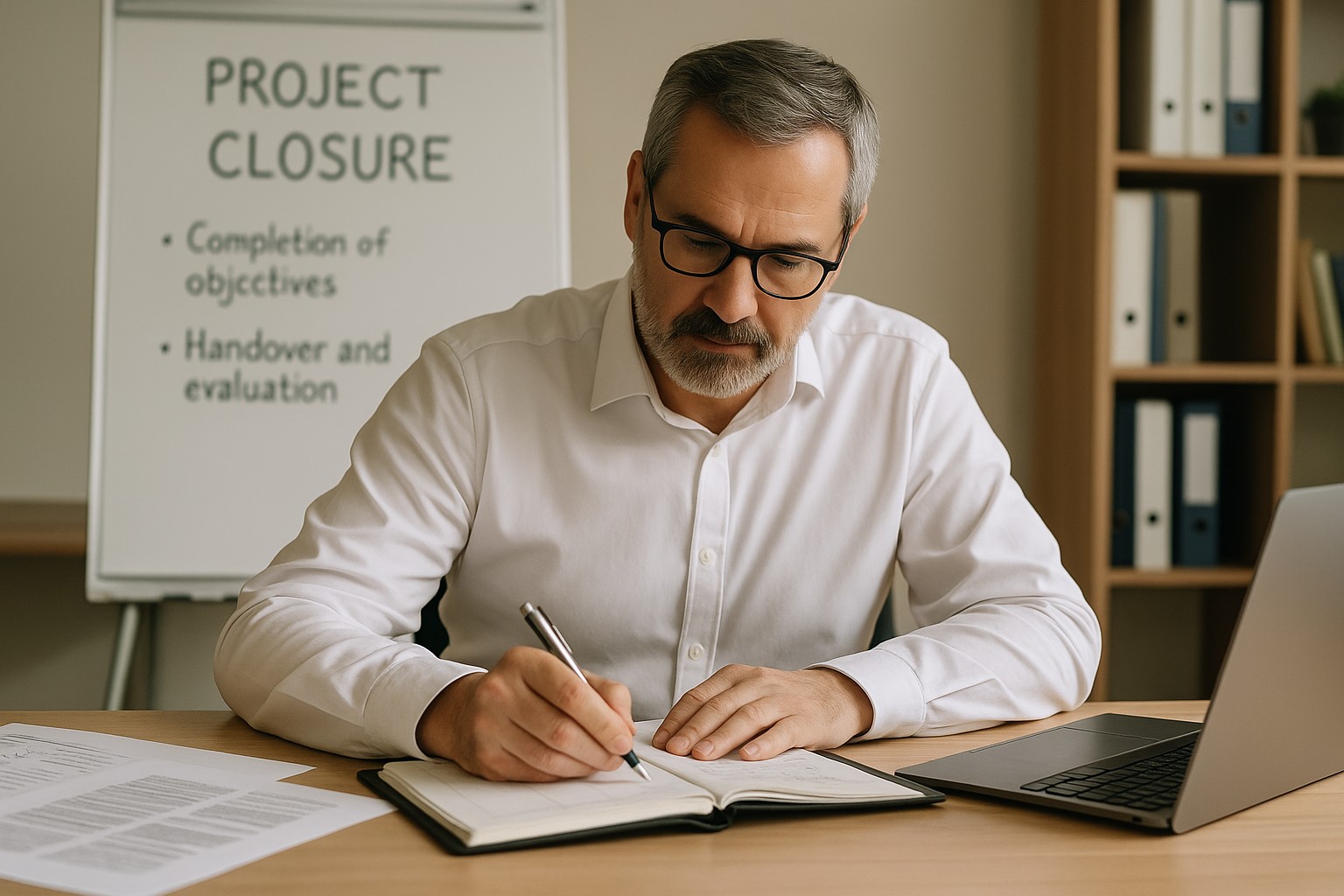Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, beginnt für den Betrieb die eigentliche Arbeit. Damit Ergebnisse dauerhaft funktionieren, braucht es mehr als ein Übergabemeeting. Es braucht Dokumente, die den Alltag unterstützen – nicht nur das Archiv füllen.
Ein gut strukturiertes Betriebshandbuch schafft genau das: Übersicht, Sicherheit und Verlässlichkeit.
Warum viele Übergaben scheitern
Zu viel, zu wenig oder schlicht das Falsche: Übergabedokumente scheitern oft an ihrem Zweck. Sie sind zu technisch für den Fachbetrieb, zu allgemein für die IT, zu detailreich für den Alltag – oder veralten direkt nach dem Projekt.
Dabei wäre die Lösung einfach: gemeinsam mit dem Betrieb erstellen, auf das Wesentliche reduzieren und für die Realität schreiben.
Was in ein Betriebshandbuch gehört – und warum
Das Ziel ist nicht „Dokumentation um der Dokumentation willen“, sondern: Hilfe zur Selbsthilfe für Betrieb, Support und Organisation.
Folgende Inhalte haben sich bewährt:
Überblick & Zweck
- Kurzbeschreibung des Projektergebnisses
- Zielgruppen: Wer nutzt dieses Dokument? Wer pflegt es?
Technisch/organisatorischer Lieferumfang
- Was wurde übergeben (Systeme, Prozesse, Verträge)?
- Abgrenzung: Was gehört nicht dazu?
Betriebsverantwortung
- Wer ist zuständig für was?
- Ansprechpartner bei Fragen, Problemen, Eskalationen
Betrieb & Pflege
- Was muss wann geprüft, aktualisiert oder erneuert werden?
- Ablaufplan für Wartungen oder Regelprozesse
- Verweise auf Verträge, SLAs oder Supportvereinbarungen
Fehlerbehandlung
- Bekannte Einschränkungen oder Schwachstellen
- Erste Schritte bei Problemen (z. B. Restart, Logging, Workarounds)
- Wiederanlaufverfahren, falls ein Ausfall auftritt
Was nicht hinein muss
Ein gutes Betriebshandbuch verzichtet bewusst auf Inhalte, die niemand nutzt oder pflegt:
- Unkommentierte Projektdokumente im Anhang
- Endloslisten ohne Struktur oder Zuständigkeit
- Historische Planstände, die nie aktualisiert werden
- Spezifikationen ohne Bezug zur Betriebsrealität
Weniger ist oft mehr – wenn das Richtige drinsteht.
Übergabeformat: digital, strukturiert, pflegbar
Ein Betriebshandbuch muss nicht schick sein – aber auffindbar, nachvollziehbar und aktuell.
Praktikable Formate sind z. B.:
- Wiki-Seiten (z. B. Confluence, SharePoint)
- Strukturierte PDFs mit Versionierung
- Integration in bestehende Ticketsysteme (z. B. als Knowledge Base-Eintrag in ServiceNow)
- Übergabe in einem gemeinsamen Workshop mit Betrieb und Projektleitung
- Referenzen auf weitere, lebende Dokumente, welche den Betrieb ergänzen oder dafür notwendig sind
Praxistipp: gemeinsam statt über den Zaun
Ein Betriebshandbuch sollte nicht vom Projekt geschrieben und dann übergeben werden.
Die besten Ergebnisse entstehen, wenn Betrieb und Projektteam es gemeinsam aufbauen – Schritt für Schritt, entlang der realen Nutzungsszenarien.
Das Ergebnis ist nicht nur verständlicher – es wird auch eher gepflegt.
Ausblick: Praxisformate & Templates
In einem der nächsten Beiträge stellen wir ein konkretes Betriebshandbuch-Template vor – mit Kommentaren, welche Abschnitte wann sinnvoll sind und wie sie aufgebaut werden können.
Außerdem zeigen wir, wie Sie Übergabedokumente mit wenig Aufwand strukturiert aufbauen – ohne Excel-Monster oder PDF-Friedhöfe.
Sie möchten Ihre Projektübergaben dauerhaft wirksam gestalten?
Wir helfen Ihnen, Betriebshandbücher aufzubauen, die genutzt – und verstanden – werden.
Ob für IT, Organisation oder Fachbereiche: Klarheit ist besser als Kontrolle.
Sprechen Sie uns an – wir sorgen dafür, dass Ihre Ergebnisse auch morgen noch funktionieren.
(Beitrag und Bild wurden mit Unterstützung von KI erstellt)