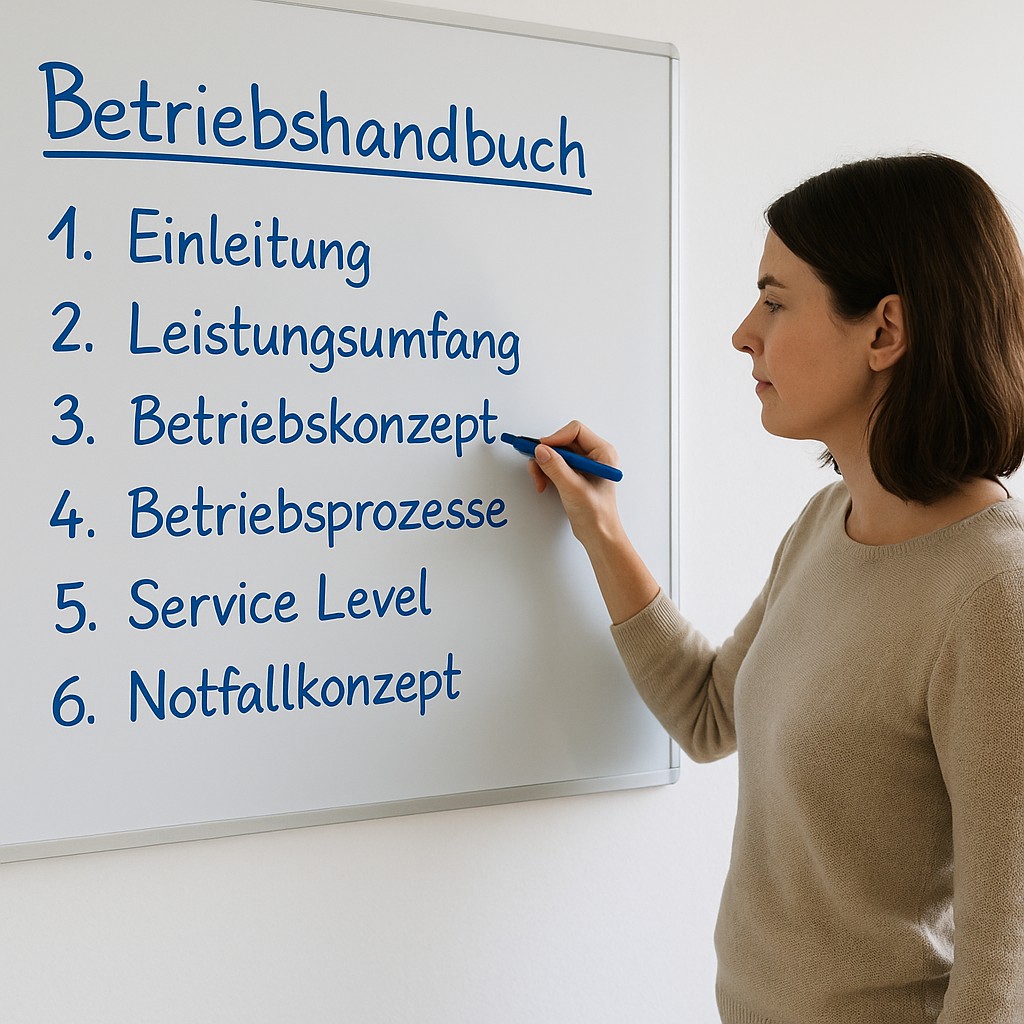Ein gutes Betriebshandbuch ist keine Sammlung von Projektartefakten, sondern eine praxisorientierte Anleitung für den Alltag. Es unterstützt Support, Fachbereiche und Betrieb – indem es das Wesentliche auffindbar, verständlich und pflegbar macht.
Während wir im letzten Beitrag den allgemeinen Ablauf dargestellt haben, stellen wir hier ein erprobtes Grundgerüst vor, das sich flexibel anpassen lässt – unabhängig von Branche, System oder Organisationstiefe. Dabei bietet es vor allem einen ersten Überblick über das Gesamtsystem, welcher Schrittweise in Tiefe und Bereite ausgebaut werden sollte. Idealerweise mit verlinkenden Prozessabläufen und Strukturen.
Das Template im Überblick
1. Deckblatt & Metadaten
- Titel, Version, Erstelldatum, Gültigkeit
- Zuständigkeiten (Autor, freigegeben durch)
- Bezug zum Projekt oder Produkt
Hinweis: Immer mit Versionskontrolle arbeiten. Das spart Diskussionen und schützt vor veralteten Inhalten.
2. Einleitung & Zielsetzung
- Kurze Beschreibung, worum es geht
- Zielgruppe (z. B. Betriebsteam, Fachbereich, Helpdesk)
- Zweck des Dokuments
Praxistipp: Keine Floskeln – 3 Sätze, die sagen, was hier drin steht und warum.
3. Übersicht der übergebenen Komponenten
- Was wurde geliefert (Systeme, Module, Prozesse)?
- Abgrenzung: Was gehört nicht dazu?
- Eventuelle Abhängigkeiten (z. B. zu Drittsystemen)
Formatidee: Tabelle mit Komponentenname, Version, verantwortlicher Betriebspartner
4. Betriebsverantwortung & Ansprechpartner
- Wer ist für was zuständig?
- Betriebsverantwortlicher, Support, Eskalation
- ggf. Betriebsübernahmeprotokoll als Anhang
Praxistipp: RACI-Matrix oder einfache Kontakttabelle reicht völlig aus – aber regelmäßig prüfen!
5. Pflege- und Wartungsroutinen
- Was muss wann gewartet oder überprüft werden?
- Automatisierte Prozesse vs. manuelle Schritte
- Hinweise auf vertraglich vereinbarte SLAs
Beispiel: “Monatlich Logrotation prüfen”, “Zertifikate alle 12 Monate erneuern”
6. Fehlerbehandlung & Wiederanlauf
- Bekannte Schwächen oder Systemgrenzen
- Erste Hilfe bei Störungen (Checkliste oder Ablaufplan)
- Wiederherstellungsverfahren (z. B. Neustart, Backup, Failover)
Optional: Links zu Systemdokumentationen oder Notfallplänen
7. Änderungsmanagement (optional)
- Wie werden zukünftige Änderungen dokumentiert?
- Wer darf was anpassen?
- Bezug zum zentralen Change- oder Release-Prozess
8. Historie & Versionierung
- Wann wurde was geändert?
- Änderungsgründe und Freigaben
Tabelle reicht: Datum – Version – Änderung – Autor
9. Anhänge
- Betriebshandbuch-Anlagen, Screenshots, Konfigurationen
- Kopien von Betriebsfreigaben, Übergabeprotokollen o. ä.
Format & Pflege
- In IT-nahen Organisationen: Confluence, SharePoint, ITSM-Systeme (z. B. ServiceNow)
- In klassischen Umgebungen: PDF oder bearbeitbares Office-Dokument mit klarer Versionsführung
- Wichtig: Pflegeverantwortung benennen – ohne sie veraltet jedes Handbuch
Ausblick
In den kommenden Beiträgen zeigen wir wie die Übergabe aus dem Projekt in den Betrieb mit verhältnismäßig wenig Aufwand strukturiert erfolgen kann.
(Beitrag und Bild wurden mit Unterstützung von KI erstellt)